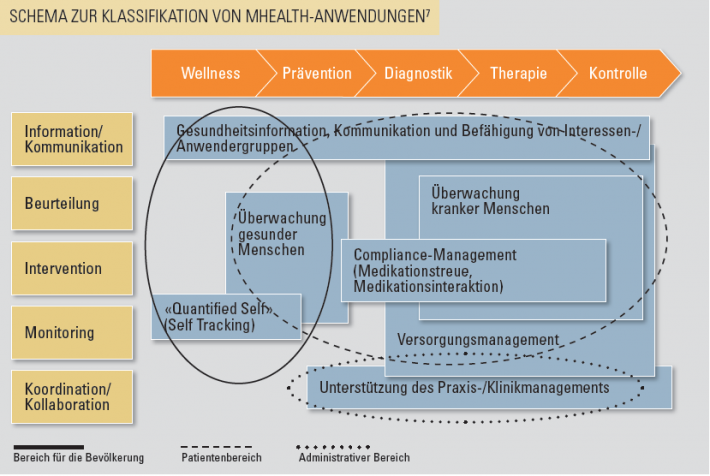Digitale Gesundheitsdaten. Der digitale Wandel verändert unseren Alltag tiefgreifend. Das Smartphone hat diese Entwicklung nochmals beschleunigt. Es ist immer und überall dabei und wird mehr und mehr auch im Bereich der Prävention und der Gesundheitsförderung (Messung von Fitness- und Gesundheitsdaten) und auch im medizinischen Alltag (Messung von Vitaldaten, Koordination und Krankheitsmanagement) eingesetzt. Der medizinische Anwendungsbereich besitzt gegenüber anderen Wirtschaftssparten allerdings Aufholbedarf, nicht zuletzt aufgrund höherer Anforderungen an die Sicherheit und den Schutz gesundheitsspezifischer Daten.
eHealth Suisse, das Koordinationsorgan von Bund und Kantonen, wurde mit der «Strategie eHealth Schweiz 2.0»1 beauftragt, die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) zu begleiten. Im Jahr 2017 hat es auch erste Empfehlungen im Umgang mit mHealth-Anwendungen herausgegeben (2). Eine Vision der Strategie eHealth 2.0 lautet, dass die Bevölkerung in der Schweiz digital kompetent ist und ihre Möglichkeiten neuer Technologien für ihre Gesundheit optimal nutzt. Gleichzeitig sollen auch Gesundheitseinrichtungen und Gesundheitsfachpersonen digital so vernetzt sein, dass sie entlang der Behandlungskette Informationen elektronisch austauschen und erfasste Daten mehrfach verwenden können (3).
„Gesundheit2020“ und digitale Technologien
Der Bundesrat ruft in seiner Strategie
«Gesundheit2020» zur Förderung des
Einsatzes digitaler Technologien auf:
Diese sollen den Behandlungsprozess
unterstützen und die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung in der
Schweiz verbessern helfen. Nebst der Einführung des EPD sieht er
Massnahmen zur Unterstützung der Entwickler von mHealth-Anwendungen
sowie höhere Transparenz bezüglich Datenschutz und Datensicherheit von
eben solchen Anwendungen gegenüber den Anwendern vor. Als Ziele nennt
die Strategie eine bessere Qualität und eine höhere Effizienz in der
Versorgung, einen verbesserten Informationsaustasch sowie effizientere
Versorgungsprozesse.
So werden Patientinnen und Patienten in Zukunft
nicht nur auf ihr EPD zugreifen können, sondern ihm auch Daten und
Unterlagen
hinzufügen können, auch solche, die von mHealth-Anwendungen
(Apps) stammen. Es könnten so raschere Diagnosen gestellt und/oder
eine Behandlung durch geeignete Applikationen begleitet werden. Ein
Beispiel: Am Inselspital Bern wird die Bariatrie-App eingesetzt, die
eine Nachversorgung nach der Magenbypass-Operation unterstützt. Generell
fehlen aber noch verbindliche
Standards zur Austauschbarkeit von In-
formationen unter mHealth-Anwendungen (im Beispiel hier etwa zwischen
Patient und Leistungserbringer).
mHealth als Teil von eHealth
mHealth (mobile Gesundheit) ist eine
Teilbereich von eHealth (4). In Anlehnung an die Definition der
Weltgesundheitsorganisation WHO wird eHealth bezeichnet als die
„medizinischen Verfahren sowie Massnahmen der privaten und öffentlichen
Gesundheitsvorsorge, die durch Mobilgeräte wie Mobiltelefone,
Patientenüberwachungsgeräte, persönliche digitale Assistenten (PDA) und
andere drahtlos angebundene Geräte unterstützt werden.“ (5)
Neue technische Möglichkeiten ersetzen keine medizinische Behandlung
Im medizinischen Alltag werden
mHealth-Anwendungen eingesetzt, die
nebst dem oben erwähnten Beispiel Vitalwerte wie Puls,
Blutzuckerspiegel,
Blutdruck, Körpertemperatur oder Gehirntätigkeiten messen oder an die
Medikamenteneinnahme oder an den bevorstehenden Arztbesuch erinnern.
Auch Fitness- und Ernährungsempfehlungen können durch
mHealth-Antwendungen abgegeben werden. Dadurch, dass immer mehr Menschen
ein Smartphone besitzen, eröffnet der Bereich mHealth den
Leistungserbringern ganz andere Möglichkeiten der Versorgung. Mobile
Gesundheitsanwendungen ersetzen jedoch in keinem Falle die ärztliche
Betreuung und die Arzt-Patienten-Kommunikation, sie können diese aber
erleichtern.
Die in dieser Ausgabe vorgestellten Praxisbeispiele
sollen einen Einblick in Entwicklungen und den möglichen Nutzen für
Anwenderinnen und Anwender, Patientinnen und Patienten sowie
Gesundheitsfachpersonen geben. Ob mit mHealth wie behauptet künftig auch
Kosten gesenkt werden können, (6) wird
sich weisen müssen. Noch fehlen vielerorts Evidenzen und somit
fundierte Ergebnisse, um mHealth-Anwendungen
im medizinischen Bereich vorbehaltslos
empfehlen bzw. einsetzen zu können. So
zeigt die App PathMate des Center for
Digital Health Interventions der Universität Sankt Gallen und der ETH
Zürich
vielversprechende Resultate (s. Interview mit Tobias Kowatsch).
Besondere Rücksicht zu nehmen ist
beim Einsatz von mHealth-Applikationen auf die Digital Immigrants, d.h.
ältere Menschen und andere benachteiligte Menschen (vgl. Artikel über
mehr
Chancengleichheit dank mHealth). Auch
sie sollen die digitalen Technologien
nutzen können, weshalb ihnen Möglichkeiten geboten werden müssen, die
dafür nötigen Kompetenzen zu erwerben.
Mobile Gesundheitsanwendungen ersetzen in keinem Falle die ärztliche Betreuung und die Arzt-Patienten-Kommunikation, sie können diese aber erleichtern.
mHealth als Medizinalprodukt
Wann mHealth-Anwendungen als Medizinprodukte gelten (d.h. als
«eigenständige Medizinprodukte-Software» bzw.
stehenden Arztbesuch erinnern. Auch «mobile medizinische
Applikation» (App), wird in der Schweiz von der
Medizinprodukteverordnung (MepV, SR 812.813), die von der europäischen
Richtlinie über Medizinprodukte (93/42/EWG) abgeleitet ist, und von der
EU-Leitlinie MEDDEV 2.1/6 geregelt. Ein Merktblatt von Swissmedic gibt
hierzu näher Auskunft („Eigenständige Medizinprodukte-Software“, siehe
Beitrag „Wann ist eine App ein Medizinprodukt?“ im Interview mit Barbara
Widmer).
In der Schweiz, den EWR-Staaten und
der Türkei werden Medizinprodukte im
Gegensatz zu Arzneimitteln nicht durch
eine behördliche Zulassung verkehrsfähig, sondern sie werden verkehrsfähig,
nachdem sie das zutreffende Konformitätsbewertungsverfahren erfolgreich
durchlaufen haben (Zertifikat bzw. EG-
Konformitätserklärung). In Verkehr gebrachte Medizinprodukte müssen zudem mit der CE-Kennzeichnung versehen sein.
Ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung von gesundheitsspezifischen
Daten
ist deren Korrektheit. Sind diese nicht
zuverlässig, gefährden sie unter Umständen die Gesundheit der
Anwenderinnen und Anwender mehr, als dass sie diese fördern. Aber auch
die Forschung
ist auf verlässliche Daten angewiesen.
Zu begrüssen wäre deshalb eine Form der Zertifizierung oder Einführung
von
Qualitätslabels, Letztere auch für Ge-
sundheits- und Fitness-Apps, die das
Vertrauen nicht nur bei Anwenderinnen
und Anwendern, sondern auch beim
medizinischen Fachpersonal erhöhen.
Datenschutz und -sicherheit vs. unternehmerische Freiheit
Gesundheitsdaten sind schon von Rechts wegen ein in besonderem Masse schützenswertes Gut. Dieses gegen Einwände der Wirtschaft auszuspielen, die darin eine Beschränkung unternehmerischer Freiheit sieht, geht deshalb nicht an. Und trotzdem: Es müssen gemeinsame Lösungen gefunden werden, damit eine Überregulierung die Möglichkeiten von mHealth für das Gesundheitssystem nicht zu sehr einschränken. Nur so können auch Produkte auf den Markt kommen, die für eine Anwendung zu Gesundheitszwecken zuverlässig und vertrauenswürdig sind sowie ethische und datenschutzrechtliche Standards erfüllen. Und so ist auch für den Hersteller ein Einsatz in diesen Markt lohnenswert. Es müssen aber auch Massnahmen getroffen werden, die es dann etwa Versicherungen oder Arbeitnehmern nicht möglich macht, Gesundheitsdaten ihrer Versicherten bzw. Angestellten unrechtmässig zu verwenden oder weiterzuverkaufen. Auch diesbezüglich ist noch einiges zu leisten (vgl. auch das Interview mit der Datenschutzexpertin Barbara Widmer).
Persönliche Sicherheit im Umgang mit eHealth
Anwenderinnen und Anwender von mHealth-Applikationen sollten heute schon minimale Sicherheitsvorkehrungen im persönlichen Gebrauch von Applikationen beachten und sich zum Beispiel nicht mit ihren Benutzerdaten für Twitter oder Facebook anmelden. App-Hersteller wiederum sollten erwähnen, welche Daten sie wo speichern, und den Nutzerinnen und Nutzern Möglichkeiten aufzeigen, selbst zu entscheiden, welche Daten sie mitteilen möchten und welche nicht (Opt-in/Opt-out). Oft hindern allgemeine Geschäftsbedingungen von Anbietern die Selbstbestimmung der Nutzerinnen und Nutzer über ihre Daten. Sie fallen meist so lang aus, dass sie gar nicht gelesen werden. Trotzdem ist man gezwungen, diesen zuzustimmen, will man Zugang zur App erhalten. In Zukunft werden digitale Technologien im Gesundheitswesen eine immer wichtigere Rolle spielen. Eine gewisse Expertise und somit ein gesundes kritisches Verhältnis gegenüber mHealth-Anwendungen von Nutzerinnen und Nutzern sowie der Behandelnden auf der einen Seite und die gemeinsam von Entwicklern, Herstellern, Experten und Fachleuten zu lösenden Aufgaben bezüglich Sicherheit, Schutz und Verlässlichkeit der Daten unter Berücksichtigung ethischer Normen auf der anderen Seite sind mitel- und längerfristig ausschlaggebend für ihren Erfolg. Sind diese Mindestanforderungen erfüllt, werden auch keine strengen Regulierungen nötig sein, die unter dem Etikett «Innovationsbremse» ins Feld geführt werden. –
(1) eHealth Suisse: Strategie eHealth Schweiz 2.0 2018–2022, vom 1.3.2018.
(2) eHealth Suisse: mobile Health: mHealth, Empfehlungen I, vom 16.3.2017.
(3) Strategie eHealth Schweiz 2.0 2018–2022, 1.3.2018, S. 4.
(4)
«Unter eHealth oder elektronischen Gesundheitsdiens- ten wird der
integrierte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologie zur
Gestaltung, Unterstützung und Vernetzung aller Prozesse und Akteure im
Gesundheitswesen verstanden.», unter: www.e-health-suisse.ch, [Stand:
13.4.2018].
(5) Aus der Studie der FHS St.
Gallen: mHealth im Kontext des elektr. Patientendossiers, Eine Studie im
Auftrag von eHealth Suisse, S. VIII; WHO World Health Organization:
mHealth. New Horizons for Health Through Mobile Technologies, Geneva,
2011, S. 6.
(6) Eine Studie von A. T. Kearney
aus dem Jahr 2013 geht von «eine[r] Verbesserung der
Patientenbehandlung und -sicherheit» sowie «nachhaltige[n]
Kostensenkungen für das Gesundheitssystem unter Nutzung der vorhandenen
technischen Infrastruktur wie Smartphones» aus, in: A. T. Kearney
(2013): Mobile Health: Fata Morgana oder Wachstumstreiber?, S. 4.
Quelle: in Anlehnung an A.T. Kearney, vgl. eHealth Suisse: mobile Health. mHealth, Empfehlungen I, vom 16.3.2017, S. 5.